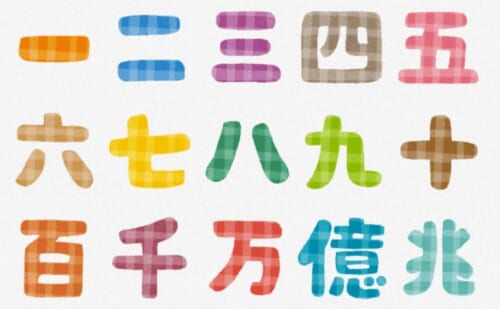Butoh (舞踏) ist eine faszinierende Art des japanischen Tanzes, der seine Zuschauer beim ersten Anblick durch seine tiefe Surrealität und seine rohen, antiästhetischen Qualitäten beeindruckt. Dieser im Nachkriegsjapan entstandene Avantgarde-Tanz entzieht sich einer einfachen Kategorisierung. Er bezieht seine Kraft aus der Schönheit, die aus Dunkelheit und Hässlichkeit entsteht. Seine minimalistische Einfachheit verbirgt tiefe Komplexität und verwandelt ihn in eine einzigartige künstlerische Manifestation, die konventionelle Vorstellungen von Schönheit und Performance in Frage stellt.
Butoh ist eine nüchterne, emotionale Kunstform, die euch einlädt, emotionale Tiefen zu erkunden, die von traditionelleren Tänzen selten erreicht werden. Und auch, wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet, den Tanz in seiner Gesamtheit zu sehen, so wird dennoch jede Aufführung zu einer persönlichen Begegnung mit dem Tiefsinnigen und Beunruhigenden zugleich. Schauen wir uns an, was Butoh so faszinierend macht.
Butoh: Eine neue Form des Ausdrucks
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan von einem tiefgreifenden sozialen und kulturellen Chaos geprägt. Die Auswirkungen des Krieges und der darauffolgenden amerikanischen Besatzung führten zu tiefgreifenden Veränderungen in der japanischen Gesellschaft. Eine Welle der Verwestlichung und Modernisierung, die viele als Aushöhlung der traditionellen kulturellen Werte empfanden, führte dazu, dass Künstler neue Ausdrucksformen suchten. Diese sollten sowohl ihre persönlichen und nationalen Traumata als auch ihre Hoffnung auf Erneuerung zum Ausdruck bringen.
In diesem Kontext war es Tatsumi Hijikata (1928-1986), der für die Entstehung des Butoh mitverantwortlich war. Der einflussreiche Tänzer wurde in Akita geboren und zog, von seinem Traum Tänzer zu werden angetrieben, nach Tokio. Hijikata lernte Ballett, Jazz und Flamenco, war aber bald mit den Einschränkungen dieser Tänze unzufrieden und begann, mit seinem eigenen Stil zu experimentieren.
Tabuthemen im Fokus
Es dauerte nicht lange, bis er Aufmerksamkeit erregte. Hijikatas frühe Werke waren proaktiv und umstritten. Sie zeichneten sich durch ungewöhnliche Bewegungen und Themen aus, die von dunklen und tabuisierten Aspekten der menschlichen Existenz inspiriert waren. Seine Performance Kinjiki (Verbotene Farben) von 1959, die homosexuelle Erotik darstellt, wird häufig als die erste Butoh-Performance überhaupt bezeichnet. Sie ist eine explosive Herausforderung an bestehende Normen und Ästhetik.
In gewisser Weise wollte er sich von übermäßigen westlichen Einflüssen befreien. Gleichzeitig wurde Hijikata jedoch stark von den Werken des französischen Schriftstellers Jean Genet beeinflusst, der für seine Werke bekannt ist, die sich auf das Elend und die Ränder der Gesellschaft konzentrieren. Ebenso wie für seine poetische Herangehensweise an das Theater. Genet inspirierte Hijikata zu seiner eigenen revolutionären Ästhetik und thematischen Auswahl im Butoh, mit der er die Außenseiter der Gesellschaft und der menschlichen Psyche hervorheben wollte.
Gleichzeitig war das titelgebende Debüt eine direkte Referenz auf die Werke von Yukio Mishima und seinen gleichnamigen Roman. Themen wie der Konflikt zwischen traditionellen japanischen Werten und westlichen Ideen, sowie Mishimas Obsession mit Schönheit, Erotik und Tod fanden bei Hijikata Anklang, als er eine Tanzform entwickelte, die ähnliche Ideen beinhaltete.
Und dennoch: Butoh wäre nicht das, was es heute ist, ohne Kazuo Ohno (1906-2010), eine weitere prägende Figur. Nachdem Ohno selbst die Schrecken des Krieges erlebt hatte, widmete er sich nach einem Treffen mit Hijitaka der neuen Tanzform und entwickelte sie mit dem Tänzer weiter. Seine Herangehensweise an Butoh war lyrischer und surrealer, und betone Transformation und Erlösung durch Tanz. Seine Aufführungen beschäftigten sich oft mit Themen wie Erinnerung, Geschlecht und Auferstehung, in starkem, aber ergänzendem Kontrast zu Hijikatas eher konfrontativem Stil.
Philosophische und künstlerische Grundlagen: Was bedeutet Butoh?
Butoh geht über typische Tanzbewegungen hinaus und wird zu einem Medium zur Erforschung tieferer philosophischer Fragen über Leben, Tod, Verzweiflung und die Absurdität der menschlichen Erfahrung. Die seltsame und oft chaotische und verworrene Art und Weise, wie Tänzer ihren Körper einsetzen, ist eine Möglichkeit, komplexe Emotionen und Seinszustände auszudrücken.
Und gerade seine rohe und zutiefst persönliche Natur macht es so schwierig, diesen Tanz einzuordnen. Aber im Allgemeinen ist ein Schlüsselaspekt, den wir erkennen können, ein visueller Stil, der aus der Aufführung mit weißer Körperbemalung und langsamen, hyperkontrollierten Bewegungen besteht. Auch Improvisation ist wichtig und ermöglich es den Tänzern, körperliche und emotionale Tiefen zu erkunden.
Obwohl Butoh eine japanische Kunstform ist, sind die darin verarbeiteten menschlichen Themen universell ansprechend. Sein revolutionärer Ansatz liegt in seiner Methode, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Butoh entfernt narrative Zwänge und konventionelle Schönheit, um das Publikum dazu zu zwingen, sich direkt mit rohen, oft auch unangenehmen Emotionen auseinanderzusetzen. Auf diese Weise fordert Butoh Zuschauer und Darsteller dazu auf, die Grenzen der Kunst und die Natur des menschlichen Ausdrucks zu überdenken.
Weltweite kulturelle Auswirkung und aktueller Stand von Butoh
Es dauerte nicht lange, bis sich das westliche Publikum in Butoh verliebte. Die visuelle und thematische Auseinandersetzung mit Dunkelheit, dem Grotesken und dem Surrealen wirkte wie eine radikale Abkehr von den oft ausgefeilteren und ästhetisch ansprechenderen Formen westlicher darstellender Kunst wie dem klassischen Ballett. Die intensiven Emotionen und die Verletzlichkeit, die in Butoh-Aufführungen gezeigt werden, können zutiefst bewegend wirken auf Zuschauende. Und daher spricht diese rohe, ungefilterte Darstellung menschlicher Emotionen das Publikum unabhängig von seinem kulturellen Hintergrund an.
Butohs minimalistischer Ansatz hingegen, der sich auf langsame, bewusste Bewegungen statt auf ausgefeilte Choreographie konzentriert, betont die Ausdruckskraft jeder Geste. Viele halten dies für eine erfrischende Abwechslung für Zuschauer, die an dynamischere und schnellere Aufführungen gewöhnt sind, und versetzt sie in einen meditativen Zustand, den man im westlichen Tanz seltener erlebt.
In Verbindung mit der häufigen Auseinandersetzung mit tiefgründigen philosophischen und existenziellen Fragen entsteht eine Form des Theaters, die intellektuell und emotional anregend ist. Für das westliche Publikum bietet dies einen einzigartigen Einblick, in dem universelle menschliche Anliegen untersucht werden können, was durch die nonverbale, global zugängliche Natur des Tanzes noch weiter erleichtert wird.
Aber auch der exotische Reiz dieser Kulturform, der tief in der japanischen Geschichte verwurzelt ist und dennoch universelle Erfahrungen anspricht, kann nicht außer Acht gelassen werden. Für das westliche Publikum ist es ein kulturelles Erlebnis, das Einblicke in japanische künstlerische Ausdrucksformen bietet und das Unbekannte mit dem Universellen verbindet. Vielleicht entsteht dadurch auch ein Raum, in dem tiefe menschliche Emotionen und existenzielle Fragen durch eine eindeutig japanische, aber allgemein zugängliche Kunstform erforscht werden.
Anerkennung im Inland mit ein wenig Hilfe von außen
Bei seiner Entstehung stellte Butoh sowohl die traditionelle japanische Kunst als auch die vorherrschenden westlichen Einflüsse auf die japanische Kultur in Frage. Daher stieß es zunächst auf starken Widerstand. Das ursprüngliche Ziel war es, etwas einzigartig Japanisches zu schaffen, das die Nachkriegserfahrung widerspiegelt. Wie bei vielen Avantgarde-Bewegungen trug die Akzeptanz und Anerkennung Butohs im Ausland auch zu seiner breiteren Anerkennung in Japan bei.
Natürlich ist das Phänomen, dass kulturelle Produkte oder Bewegungen in ihrem Ursprungsland an Ansehen und Anerkennung gewinnen, nachdem sie international gefeiert wurden, nicht nur auf Butoh oder Japan beschränkt. Aber es ist interessant, wie sich in diesem Fall angesichts der Ursprünge von Butoh ein komplexes Zusammenspiel zwischen nationaler Identität, kulturellem Wert und globaler Anerkennung widerspiegelt.
Der internationale Erfolg des Butoh unterstrich nicht nur seine weltweite Anziehungskraft und seinen künstlerischen Wert, sondern förderte auch seine Neubewertung der Kunstform in Japan, was zu einer größeren Akzeptanz und Wertschätzung seines innovativen Ansatzes in Tanz und darstellender Kunst führte. Diese externe Anerkennung spielte eine Schlüsselrolle bei der Veränderung der Wahrnehmung und der Erhöhung der Legitimität des Butoh innerhalb der japanischen Kultur- und Künstlergemeinschaften.
Butoh in Japan heute
Wenn ihr euch fragt, wo ihr heutzutage Butoh in Japan sehen könnt, dann werdet ihr euch freuen zu hören, dass die zeitgenössische Butoh-Szene glücklicherweise nach wie vor lebendig ist. Geprägt ist sie von mehreren namenhaften Persönlichkeiten, die die Kunstform in neue Richtungen geführt haben und auf der grundlegenden Arbeit von Hijikata und Ohno aufbauen. Hier sind einige der wichtigsten Butoh-Persönlichkeiten der letzten Jahre:
Yoshito Ohno: Bis zu seinem Tod im Jahr 2020 hielt er das Erbe seines Vaters Kazuo Ohno aufrecht, der eine wichtige Figur bei der Erhaltung der traditionellen Aspekte des Butoh war und gleichzeitig neue Gebiete erkundete. Ohno trat oft auf und unterrichtete und stellte so eine Verbindung zwischen den ursprünglichen Butoh-Praktizierenden und der neuen Generation von Tänzern her.
Dairakudakan: Diese Butoh-Gruppe unter der Leitung von Akaji Maro ist eine weitere einflussreiche Gruppe. Darakudakan wurde 1972 gegründet und produziert groß angelegte Ensemblewerke, die dramatisch sind und oft von einem Hauch des Fantastischen oder Surrealen durchdrungen sind. Maros Arbeit ist theatralisch, er verwendet aufwendige Bühnenbilder und Kostüme, und seine Aufführungen beinhalten oft Elemente der japanischen Mythologie und Folklore.
Sankai Juku: Der verstorbene Ushio Amagatsu gründete 1975 Sankai Juku. Heutzutage eine der international renommiertesten Butoh-Gruppen. Amagatsus Arbeit war bekannt für seine poetischen und visuell beeindruckenden Darbietungen, die oft universelle Themen wie Leben, Tod und Wiedergeburt behandeln. Sankai Juku tritt weltweit auf und bringt Butoh mit einem Stil, der Schönheit und Transzendenz betont, einem globalen Publikum näher.
Min Tanaka: Obwohl er sich vom Butoh abgewandt hat, gilt er noch immer als Avantgarde-Tänzer, der früher mit Hijikatas Butoh verwandt war. Sein künstlerischer Ansatz beinhaltete ein Konzept, das er „Body Weather“ nennt und das die Beziehung zwischen Körper und Umwelt untersucht. Er betont die körperliche Strenge und die Verbindung mit natürlichen Landschaften in seinen Performances, die er oft im Freien durchführt und bei denen er die Umgebung als integralen Bestandteil seines Ausdrucks nutzt. Tanaka tritt auch als obdachloser Tänzer in Wim Wenders gefeiertem Film „Perfect Days“ auf, der vollständig in Tokio spielt.
Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Butoh von einer spezifischen kulturellen Reaktion zu einer vielseitigen und weltweit anerkannten Form des künstlerischen Ausdrucks entwickelt hat. Seine Anpassungsfähigkeit und Tiefe haben es ihm ermöglicht, in der zeitgenössischen Kunst weiterhin relevant zu bleiben und das Publikum auf der ganzen Welt weiterhin herauszufordern und zu inspirieren.
Übersetzung von Yvonne Tanaka.